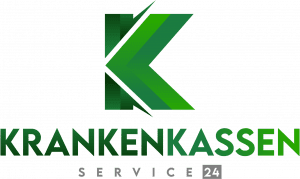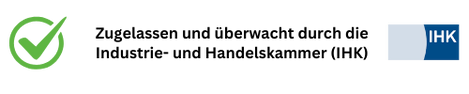Krankenversicherung Beamte
Beamten müssen sich selbst um Ihre Krankenversicherung kümmern. Du bist noch im Referendariat? dann solltest du diesen Artikel für Referendare lesen.
Personen, die sich in der Ausbildung zum Beamtenberuf befinden, werden als Beamte auf Widerruf bezeichnet. Man unterscheidet Beamtenanwärter in der Ausbildung für den:
Mit Antritt einer Stelle beginnt für Lehrer eine Probezeit von mindestens drei Jahren. Mit dem Beginn der Probezeit ist man “Beamter auf Probe”.
Nach erfolgreicher Probezeit wird man „Beamter auf Lebenszeit“. Der bereits bestehende Versicherungsschutz wird fortgeführt.
Weitere Informationen zur Beihilfestelle wie Formulare, Anträge etc., findest du hier.
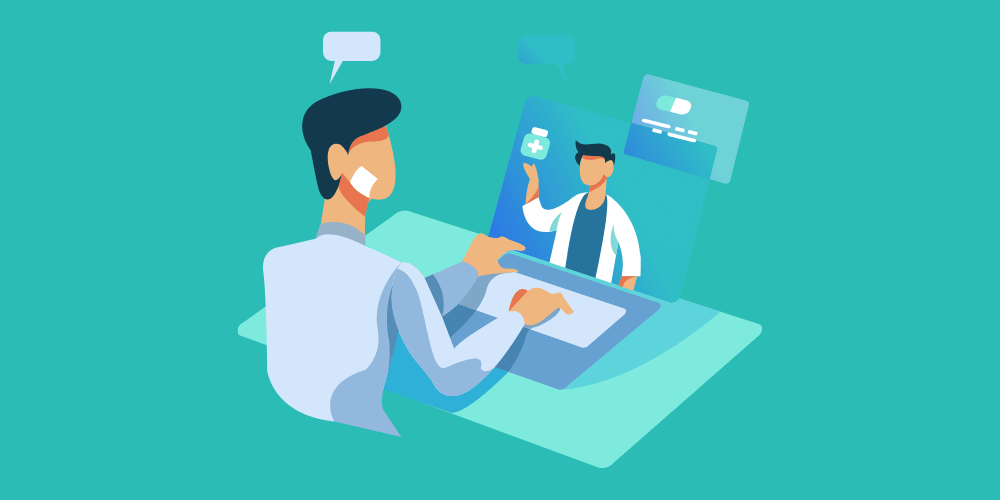
Unabhängige Beratung Private Krankenversicherung
Durch unsere unabhängige Beratung zur privaten Krankenversicherung bekommst du eine umfangreiche Analyse. Im Vergleich sind über 40+ Anbieter. Ebenfalls wird das Kleingedruckte analysiert und die Preise transparent dargestellt.
Inhaltsverzeichnis

Krankenversicherung Beamte Voraussetzungen
Krankenversicherung Beamte nach Beamtenstatus
Krankenversicherung Beamte Beihilfesätze
Beihilfe-Sätze auf einem Blick
Krankenversicherung Beamte Vorteile und Nachteile
Private Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenversicherung
Krankenversicherung Beamte Leistungsübersicht
Unverzichtbare Leistungen
Unverzichtbare Leistungen
Arzthonorare
Viele Ärzte rechnen in Deutschland nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) oder Zahnärzte (GOZ) ab. Für die meisten Patienten und Behandlungen reicht es aus, wenn die Krankenversicherung den Regelhöchstsatz (2,3-fache der GOÄ/GOZ) oder den Höchstsatz (3,5-fache) erstattet. Andere Tarife, die weniger als den Regelsatz erstatten, sind nicht zu empfehlen. Solltest Du auch Behandlungen durch Spezialisten oder Privatkliniken versichern möchtest – also das, was über die Leistungen einer gesetzlichen Krankenversicherung hinaus geht – dann solltest Du einen Tarif auswählen, der auch über dem Höchstsatz oder ohne Bezug auf die Gebührenverordnung leistet.
Arztwahl
Primärarzttarife (Hausarzttarife) schreiben dir vor, dass du immer zuerst einen bestimmten Arzt aufsuchen musst (i.d.R. Hausarzt). Solltest du dich direkt an einen Facharzt wenden, dann kann die Krankenversicherung ihre Leistungen kürzen. Hast du dagegen die „freie Arztwahl“ vereinbart, kannst du direkt einen Facharzt aufsuchen und unter den niedergelassenen Ärzten selbst auswählen. Möchtest du im Krankenhaus vom Chefarzt (sehr erfahren) behandelt werden, anstatt von dem diensthabenden Arzt (oftmals neue Ärzte) musst du die privatärztliche Behandlungen mitversichern. Behandlungen durch sogenannte Heilhilfsberufe wie Logopädinnen oder Physiotherapeuten sind ebenfalls nur mitversichert, wenn dies gesondert in deinem Vertrag steht.
Ein- oder Zweibettzimmer
Einen Krankenhausaufenthalt im Einbettzimmer- oder Zweitbettzimmer zu verbringen, ist angenehmer. So hast du deine Ruhe und musst keine Rücksicht auf andere Patienten nehmen. Du kannst in Ruhe schlafen, genießt deine Ruhe und auch unangenehme Gerüche und das Stöhnen bleibt dir erspart. Wähle daher ein Zwei- oder noch besser ein Einbettzimmer.
Medikamente
Hier solltest du auf mögliche Selbstbehalte oder Beschränkungen bei der Erstattung achten. Zahlungen für Medikamente sollten möglichst nicht auf Generika ( Nachahmer-Produkte) beschränkt sein.
Hilfsmittel
Hilfsmittel unterstützen dich, körperliche Defizite auszugleichen. Das beginnt von lebenserhaltenden Hilfsmitteln wie Beatmungsgeräten über sogenannte Körperersatzstücke (Prothesen, Kunstaugen) bis hin zu Rollstühlen. Aber auch orthopädische Hilfsmittel wie Gehhilfen, Brillen, Blindenhunde oder künstliche Kehlköpfe gehören dazu.
Wer einmal auf ein Hilfsmittel angewiesen ist, möchte dieses im Ernstfall in möglichst bester Qualität erstattet bekommen. Prüfe deshalb bei allen Hilfsmitteln darauf, inwieweit diese von der Krankenversicherung erstattet werden. Unter Umständen gibt es prozentuale oder preisliche Begrenzungen.
Einige Versicherer erstatten auch nur eine „einfache Ausführung“. Was genau als „einfache Ausführung“ gilt, wird dann erst im Leistungsfall festgelegt.
Den genauen Umfang der Leistung findest du im Hilfsmittelkatalog der Versicherung. Diesen gibt es in zwei Varianten:
Der geschlossene Hilfsmittel-Katalog gibt eine festgelegte Liste an Hilfsmitteln, die erstattet werden. Diese Liste bleibt gleich – was dort nicht genannt ist, wird auch in Zukunft nicht erstattet. Dies gilt ebenfalls, wenn es das Hilfsmittel heute noch gar nicht gibt. Daher ist diese Variante nicht empfehlenswert.
Der offene Hilfsmittel-Katalog gibt keine festgelegte Liste Hilfsmitteln an, die erstattet werden. Durch diese Formulierung werden in Zukunft auch technische Neuerungen bezahlt. Ein offener Katalog ist deshalb zu empfehlen.
Krankengeld
Jeder private Krankenversicherte sollte ein Krankentagegeld mindestens analog der gesetzlichen Krankenversicherung versichern, da ohne Krankentagegeld die monatlichen Kosten für Miete, Essen, Auto, Strom etc. im Krankheitsfall nicht gedeckt werden können. Für Selbstständige & Freiberufler ist dies oftmals die einzige Option, sich gegen einen vorübergehenden Verdienstausfall durch Krankheit abzusichern. Angestellte die gesetzlich krankenversichert sind, erhalten sechs Wochen lang den Lohn vom Arbeitgeber weiterbezahlt. Danach springt bei gesetzlich versicherten Arbeitnehmern die Krankenkasse ein und zahlt ein Krankengeld. Als Privatversicherter ist es deine Pflicht ein Krankentagegeld zu vereinbaren. Für Arbeitnehmer ist ein Krankentagegeld ab dem 43. Tag sinnvoll. Selbstständige & Freiberufler können z.B. ab dem 7. Tag oder später ein Krankengeld vereinbaren. Je früher das Krankentagegeld bezahlt werden soll, desto preisintensiver ist es.
Zahnleistungen
Die Versicherungsbedingungen der Krankenversicherungen unterscheiden zwischen:
- Zahnbehandlung
- Zahnersatz
- Kieferorthopädie
Zuerst solltest du auf die sogenannte Zahnstaffel achten. Diese begrenzt die Erstattungen meist in den ersten Jahren auf einen bestimmten Höchstbetrag (z.B. 3.000 €) – entweder für die gesamte Zeit oder pro Jahr.
Marktüblich sind bis zu fünf Jahre, doch auch längere Zeiträume sind möglich. Manchmal gilt die Zahnstaffel nur für den Zahnersatz.
Danach solltest du dir die Erstattungshöhen bei Zahnbehandlung und Zahnersatz anschauen. Sehr gute Tarife übernehmen Kosten für die Zahnbehandlung zu 100% und für den Zahnersatz zwischen 80-90%.
Darüber hinaus ist es wichtig, wieviel die Krankenversicherung für Inlays und Implantate sowie Material- und Laborkosten erstattet. Viele Tarife erstatten Kieferorthopädie bei Erwachsenen nur, sofern auch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zahlen würde.
Sehr wichtige Leistungen
Psychotherapie
Psychotherapie ist grundsätzlich im Versicherungsumfang als medizinisch notwendige Leistung enthalten, sowohl stationär in der Klinik als auch ambulant beim Arzt. Allerdings gibt es oft Einschränkungen, besonders bei der ambulanten Psychotherapie. Es empfiehlt sich, mindestens 50 Sitzungen zu versichern. Zum Vergleich: Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) übernimmt bei Langzeittherapien zwischen 60 und 160 Sitzungen.
Es ist ratsam, einen Vertrag zu wählen, der möglichst wenige Einschränkungen enthält:
- Keine prozentuale Selbstbeteiligung
- Keine Begrenzung der Sitzungsanzahl
- Keine Notwendigkeit, Behandlungen vorab von der Versicherung genehmigen zu lassen
Wichtig zu wissen ist auch, dass sowohl Fachärzte als auch Psychologen mit Zusatzausbildung berechtigt sind, psychotherapeutische Behandlungen durchzuführen.
Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass Leistungen von Fachärzten in der privaten Krankenversicherung (PKV) automatisch abgedeckt sind, während die Behandlung durch Psychologen nur erstattet wird, wenn dies explizit im Vertrag festgehalten ist. Besonders im ambulanten Bereich arbeiten häufig psychologische Psychotherapeuten, weshalb diese Absicherung sehr zu empfehlen ist.
Heilmittel
Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und Podologie sollten unbedingt im Versicherungsschutz enthalten sein. Die Kosten für eine langfristige Therapie können erheblich sein, wenn du sie selbst bezahlen musst. Achte darauf, dass nicht nur Ärzte, sondern auch Therapeuten dich behandeln dürfen. Diese Details sind in den Versicherungsbedingungen zu finden.
Stationäre Versorgung
Stelle sicher, dass deine Krankenversicherung die Möglichkeit einer Behandlung in Privatkliniken oder ausländischen Krankenhäusern abdeckt.
Viele spezialisierte Kliniken, wie zum Beispiel Herz-Zentren oder Krankenhäuser in Kurorten, bieten nicht nur normale Krankenhausbehandlungen, sondern auch Rehabilitationsmaßnahmen (Reha) oder Kuren an. Diese sogenannten gemischten Anstalten müssen oft gezielt in deinem Versicherungstarif mitversichert werden, da private Krankenversicherungen normalerweise dafür nicht automatisch aufkommen.
Besonders wichtig ist dies, wenn du in einem Kurort lebst, wo solche Kliniken häufig die einzige Option vor Ort darstellen. In Notfällen sollte auch die Behandlung in gemischten Anstalten möglich sein.
Einige Versicherungen verlangen zudem, dass Patienten ihren Krankenhausaufenthalt innerhalb einer bestimmten Frist melden müssen, um volle Erstattung zu erhalten. Es ist ratsam, einen Tarif zu wählen, der keine solche Meldefristen hat, wenn möglich.
Anschlussheilbehandlung/Kur/Reha
Üblicherweise übernimmt die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) oder gesetzliche Unfallversicherung (GUV) die Kosten einer Rehabilitationsmaßnahme (Reha) oder der Anschlussheilbehandlung nach einem Klinikaufenthalt. Solltest Du als Selbstständiger dort aber nicht versichert sein, solltest Du ein besonderes Augenmerk auf diese Klausel legen. Für Angestellte ergänzt diese Klausel die Leistungen der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung.
Die Heilbehandlungen sollten vom Grundsatz her mitversichert sein. Es sollte keine Liste oder Aufzählungen von schweren oder vorab definierten Erkrankungen geben. Besonders die Definition schwerer Erkrankungen ist immer Auslegungssache. Prüfe ebenfalls, ob es Fristen gibt, innerhalb derer Du eine Rehabilitationsmaßnahme (Reha) antreten musst. Je nach Erkrankung kann es eine Weile dauern, bis Du fit genug für eine Rehabilitationsmaßnahme (Reha) bist. Die beste Variante ist, wenn im Vertrag keine Fristen festgelegt sind, sondern die Behandlung erst beginnen muss, wenn dies medizinisch wieder möglich ist.
Auch Entziehungsmaßnahmen für Suchtkranke (z.B. Alkohol, Drogen, Spielsucht etc.) sind nicht automatisch mitversichert. Soll deine Krankenversicherung die Kosten übernehmen, sollte dies im Vertrag vereinbart sein. Die erste Entziehung sollte möglichst versichert sein.
Transportkosten
Der Transport zum Arzt oder ins Krankenhaus, sollte ebenfalls im Umfang enthalten sein. In Notfällen oder zur Erstversorgung nach einem Unfall sollten Transportkosten auch dann versichert sein, wenn Du schlussendlich nur ambulant behandelt wirst. Achte daher darauf, dass möglichst alle Transportmittel erstattet werden (z.B. ein Notfallflug mit dem Hubschrauber). Wähle darüber hinaus möglichst einen Tarif ohne Beschränkung des Transportweges, auf den nächstgelegenen Behandler oder auf Höchstbeträge. Auch Kosten für den Transport zu Dialyse-, Strahlen- und Chemotherapie sollte die Krankenversicherung übernehmen.
Vorsorgeuntersuchungen/Impfungen
Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen gesetzlich eingeführter Programme wie z.B. die Krebsfrüherkennung, sind auch in jeder privaten Krankenversicherung (PKV) grundsätzlich mitversichert. Einige private Tarife erstatten über gesetzliche eingeführte Programme hinaus ohne Beschränkungen.
Achte daher ggf. auch auf Alterseinschränkungen zu den Vorsorgeuntersuchungen und ob ein Leistungsverzeichnis vorhanden ist. Ein Leistungsverzeichnis führt bestimmte Untersuchungen auf, die erstattungsfähig sind. Wähle daher einen Tarif aus, der auf das Leistungsverzeichnis verzichtet. In der Praxis führt dies oftmals zu Ärger bei der Behandlung und Leistungserstattung.
Schutzimpfungen müssen hingegen gesondert in den Versicherungsbedingungen aufgeführt sein, damit diese erstattungsfähig sind. Der Umfang sollte mindestens den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) entsprechen.
Heilpraktiker
Viele Tarife auf dem Markt sehen für den Heilpraktiker nur eingeschränkte Erstattung von. In der Regel reicht bei der Erstattung von Honoraren, der Höchstbetrag der Gebührenverordnung für Heilpraktiker (GebüH) aus.
Sehhilfen
Viele Tarife erstatten die Kosten für Brillen, Kontaktlinsen oder Laser-Behandlungen (Lasik). Beachte dennoch die Höchstgrenzen, bis zu welcher Höhe z.B. eine Brille erstattet wird und nach wie vielen Jahren du erneut Anspruch auf eine neue hast.
Beitragsrückerstattung (Cashback)
Für den Fall, dass Du keine Rechnungen einreichst innerhalb eines Jahres einreichst, kannst du eine mögliche Beitragsrückerstattung erhalten. Hier unterscheiden die Krankenversicherung zwischen:
1. Erfolgsabhängiger Beitragsrückerstattung:
Die Beitragsrückerstattung ist abhängig vom Erfolg (Ertragslage) des Versicherers.
2. Erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung (Garantierte Rückerstattung):
Die Beitragsrückerstattung ist garantiert. Solltest du innerhalb von einem Jahr keine Rechnung einreichen, erhältst du z.B. zwei Monatsbeiträge auf dein Konto ausgezahlt.
Tipp: Vergleiche deine Beitragsrückerstattung mit deinen bisherigen Leistungen z. B.:
Beitragsrückerstattung = 1.200 € pro Jahr
Rechnungen für Arztbesuche und Medikamente = 300 € pro Jahr
Hier lohnt sich definitiv die Rechnungen nicht einzureichen und die Beitragsrückerstattung zu nehmen. Hier machst du unterm Strich 900 € mehr in der Tasche für den nächsten Urlaub.
Wechseloptionen
Bei einigen Tarifen besteht das Option, unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsschutz zu erweitern oder die Selbstbeteiligung zu reduzieren, ohne eine erneute Gesundheitsprüfung und Wartezeiten. Dieses Option nennt sich Optionsrecht. Dieses Wechselrecht kann für Dich sinnvoll sein, wenn du Dich für den Grundschutz entscheidest (nicht empfohlen).
Vorsicht: Dieses Optionsrecht kannst Du nur in einem begrenzten Rahmen nutzen. Oftmals gibt es bestimmte Termine, Altersgrenzen oder Anlässe wie Verbeamtung, Heirat oder Geburt eines Kindes. Wird der entsprechende Zeitpunkt verpasst, verfällt die Wechseloption.
Leistungen, über die du nachdenken solltest
Selbstbehalt
Mit der Selbstbeteiligung hast du die Möglichkeit, deine monatlichen Beiträge zur Krankenversicherung zu reduzieren. Diese Option ist besonders attraktiv, wenn du selten ärztliche Leistungen in Anspruch nimmst, da du so signifikant sparen kannst. Allerdings ist es wichtig, die Selbstbeteiligung bei der Berechnung und dem Vergleich unterschiedlicher Tarifpreise einzubeziehen.
Selbstbeteiligung und Beitragsberechnung
Um die tatsächlichen Kosten der verschiedenen Tarife zu vergleichen, solltest du die Selbstbeteiligung in den monatlichen Beitrag einrechnen. Dies gibt dir einen realistischen Überblick über die jährlichen Gesamtkosten deiner Krankenversicherung.
Wichtiger Tipp zur Selbstbeteiligung
Es ist zu beachten, dass eine hohe Selbstbeteiligung in der Regel nur durch eine erneute Gesundheitsprüfung gesenkt werden kann. Mit steigendem Alter wird dies zunehmend schwieriger. Daher solltest du dich nicht leichtfertig auf eine hohe Selbstbeteiligung einlassen. Im Rentenalter, ab 67 Jahren, könnte sich eine solche Entscheidung als nachteilig erweisen.
Selbstbeteiligung für Selbstständige und Freiberufler
Für Selbstständige und Freiberufler kann eine höhere Selbstbeteiligung vorteilhafter sein als für Angestellte. Während Angestellte die Hälfte ihrer Krankenversicherungsbeiträge vom Arbeitgeber erstattet bekommen, profitieren sie nur bedingt von einer hohen Selbstbeteiligung. Der Arbeitgeber zahlt zwar weniger Beiträge durch den vereinbarten Selbstbehalt, beteiligt sich jedoch nicht an den zusätzlichen Kosten, die durch die Selbstbeteiligung entstehen.
Beitragsentlastung im Alter
Um im Alter die Beiträge deiner privaten Krankenversicherung zu senken, bieten viele Anbieter einen Beitragsentlastungsbaustein an. Mit diesem Baustein kannst du schon jetzt für eine Entlastung in der Zukunft sorgen. Du zahlst monatlich in diesen Baustein ein, und das angesparte Geld reduziert später deine Versicherungsbeiträge. Beispielsweise kannst du mit einer monatlichen Investition von 78 € eine Beitragsentlastung von 300 € im Rentenalter erreichen. Wenn dein Beitrag bei Rentenbeginn 750 € beträgt, reduziert die private Krankenversicherung deinen monatlichen Beitrag um 300 € auf 450 €. So kannst du finanziell entspannter in den Ruhestand gehen.
Palliativversorgung/Hospiz
Die Kostenübernahme für Palliativ- und Hospizversorgung (Schmerztherapie und Sterbebegleitung im Endstadium schwerer Krankheiten) ist ein wichtiger Bestandteil einer guten Krankenversicherung. Achte darauf, dass dein Tarif diese Leistungen einschließt, da einige Tarife besonders die Palliativmedizin einschränken. Eine umfassende Versicherung sollte mindestens die stationäre und teilstationäre Versorgung im Hospiz abdecken.
Kindernachversicherung
Neugeborene können ohne erneute Gesundheitsprüfung privat krankenversichert werden. Dabei darf der Versicherungsschutz der Kinder nicht höher oder umfangreicher sein als der der Eltern. Entscheidest du dich also für einen günstigen Tarif mit begrenzten Leistungen, erhält dein Kind ebenfalls nur diesen begrenzten Schutz. Möchtest du deinem Kind einen umfassenderen Versicherungsschutz bieten, ist eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich.
Wichtige Kennzahlen zur Auswahl für die Krankenversicherung Beamte
Finanzkraft
- Platz 1: R+V
- Platz 2: Signal Iduna
- Platz 3: Hanse Merkur
- Platz 4. ARAG
- Platz 5: Hallesche
- Platz 6: AXA/DBV
- Platz 7: Barmenia
- Platz 8: Concorida
- Platz 9: Continentale
- Platz 10: DKV
Niedrigste Beschwerdequote
- Platz 1. R+V
- Platz 2. UKV
- Platz 3. Alte Oldenburger
- Platz 4. Signal Iduna
- Platz 5. DKV
- Platz 6. Hanse Merkur
- Platz 7. Barmenia
- Platz 8. Continentale
- Platz 9. Nürnberger
- Platz 10. ARAG
Fazit Krankenversicherung Beamte
Die Krankenversicherung für Beamte ist sowohl in der gesetzlichen- als auch in der privaten Krankenversicherung möglich. Die gesetzliche Krankenversicherung kann nur im Rahmen der pauschalen Beihilfe genutzt werden. Dort werden die Beiträge anhand des Einkommens bestimmt. Je höher das Einkommen, desto höher die Beiträge. Die Private Krankenversicherung für Beamte wird mit der individuellen Beihilfe gewährt. Die Beiträge in der privaten Krankenversicherung richten sich nach dem Eintrittsalter und dem aktuellen Gesundheitszustand. Diese sind unabhängig von Einkommen. Wer in die private Krankenversicherung wechseln kann, sollte dies natürlich durchführen.
Wichtige Fragen zur Krankenversicherung Beamte für dich beantwortet
Grundsätzlich erstattet die Beihilfe alle wirtschaftlich angemessenen Aufwendungen für notwendige Behandlungen. Wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt, kommt Sie also immer ins Spiel. Die bundes- und landesrechtlich geregelte Fürsorgepflicht hat jedoch Ihre Grenzen, sodass unterschiedlichste Leistungseinschränkungen je nach Beihilfeverordnung bestehen können. Bestimmte Leistungen sind je nach Bundesland in den Beihilfevorschriften ausgenommen. Dazu können gehören:
- Medizinische Maßnahmen, die nicht aufgrund einer Erkrankung durchgeführt werden
- Bestimmte Wahlleistungen bei einem Krankenhausaufenthalt, etwa Chefarztbehandlung oder ein Ein-/Zweibettzimmer
- Ein höherwertiger Zahnersatz als normal nötig, in Form von Kronen oder Implantaten aus Keramik
Zusätzliche Lücken resultieren für Beamte dadurch, dass der Dienstherr nicht sämtliche Kosten als beihilfefähig anerkennt, sondern Beihilfe nur auf sogenannte „beihilfefähige Aufwendungen“ gewährt. Manche Behandlungsmethoden oder Arzneimittel sind so von der Erstattung voll oder teilweise ausgenommen. Ein Teil der Kosten muss daher selbst getragen werden. Diese Lücken schließen Sie mit speziellen Beihilfeergänzungstarifen (Bausteinen).
Um Beihilfe für Ihre Krankheits-Aufwendungen zu erhalten, müssen Sie einen Antrag bei einer Festsetzungsstelle stellen. Welche Stelle für Sie zuständig ist, hängt von Ihrem jeweiligen Dienstherrn ab.
In den Beihilfestellen von Bund und Ländern erhalten Sie die notwendigen Formulare. Mittlerweile werden diese Formulare auch online bereitgestellt. Hier tragen Sie einfach alle benötigten Angaben ein und reichen den Antrag im Anschluss bei der entsprechenden Behörde ein. Wird der Antrag für Beihilfe zum ersten Mal ausgefüllt, werden von der Beihilfestelle besonders viele Informationen verlangt. Da noch keine Daten von Ihnen hinterlegt sind, müssen Sie beispielsweise Angaben über Ihren Status, Ihre Dienststelle und beihilfeberechtigte Familienmitglieder machen. So kann die Festsetzungsstelle Ihren individuellen Bemessungssatz berechnen.
Ja. Für den Anteil der Krankheitskosten, der nicht von der Beihilfe abgedeckt ist, gibt es eine gesetzliche Verpflichtung eine private Krankenversicherung abzuschließen. Nach § 193 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz müssen beihilfeberechtigte Personen nämlich einen entsprechenden privaten Krankenversicherungsschutz abschließen und aufrechterhalten.
Einen auf den genauen Beihilfesatz abgestimmten Tarif für die verbleibenden Prozente der Krankheitskosten können alle Personen mit Beihilfeanspruch bei einer privaten Krankenkasse abschließen. Darüber hinausgehende Zusatzleistungen können ebenfalls über sogenannte Beihilfeergänzungstarife abgesichert werden.
Beihilfeberechtigte erhalten auch für Ehe- und Lebenspartner eine Beihilfe für die entstehenden Krankheitskosten. Je nach Bundesland kann diese bis zu 70 Prozent der beihilfefähigen Aufwendungen betragen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die jeweiligen Angehörigen berücksichtigungsfähig sind. Das sind sie in der Regel, wenn sie ein bestimmtes Jahreseinkommen ca. 20.000 Euro (2021) nicht überschreiten. Berücksichtigungsfähige Angehörige sind beispielsweise:
- Ehepartner des Beihilfeberechtigten
- Eingetragene Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (gilt nicht in Bremen)
Beispiel aus der Praxis: Gemäß der Beihilfevorschrift des Bundes ist der Ehegatte berücksichtigungsfähig, wenn im zweiten Kalenderjahr vor Beihilfeantragstellung die Einkommensgrenze von 20.000 Euro nicht überschritten wurde. Soll für den Ehegatten 2021 Beihilfe beantragt werden, so werden die Einkünfte des Jahres 2019 zugrunde gelegt.
Die freie Heilfürsorge ist eine spezielle Form der Kostenübernahme der Gesundheitsleistungen von Beamten. Sie wird i.d.R. dann gewährt, wenn die Person in einem öffentlich-rechtlichen Amts- oder Dienstverhältnis beschäftigt ist und die Tätigkeit besonders gefahrenbelastet ist. Die freie Heilfürsorge übernimmt im Gegensatz zu der Beihilfe 100 Prozent der Kosten von erstattungsfähigen Aufwendungen.
Freie Heilfürsorge erhalten folgende Personen: Vollzugsbeamte der Bundespolizei sowie Berufs- und Zeitsoldaten während des aktiven Dienstes. Bei Polizeibeamten der Länder gelten andere spezifische Regelungen. Die freie Heilfürsorge wird jedoch nur den vorgenannten Personengruppen selbst gewährt – für etwaige berücksichtigungsfähige Angehörige wird weiterhin die Beihilfe entsprechend der jeweiligen Vorschrift gezahlt.
Endet die freie Heilfürsorge, wird automatisch wieder Beihilfe gewährt. Genau aus diesem Grund sollten davon betroffene Beamte schon während ihres Anspruchs auf Heilfürsorge eine Anwartschaftsversicherung auf die später benötigten Beihilfetarife abschließen. Nur dadurch ist schon jetzt sichergestellt, dass nach dem Ende der freien Heilfürsorge eine vollwertige private Krankenversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung und ohne mögliche Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse beantragt werden kann. Ohne bestehende Anwartschaft bleibt nur noch die Aufnahme im Basistarif für die Beihilfeberechtigten. Das bedeutet: geringere Leistungen gegen höhere Beiträge.
Die Anwartschaft oder auch Anwartschaftsversicherung ist eine Option (Möglichkeit) auf eine beihilfekonforme Krankenversicherung. Sie bietet Studenten (Lehramtsstudenten) oder Beamten eine sehr wichtige Möglichkeit, um sich vor hohen Beiträgen in der Krankenversicherung aufgrund eines Unfalles oder Krankheitsfalles zu schützen. Während dieser Option besteht kein aktiver Versicherungsschutz.
Die Anwartschaftsversicherung sichert den aktuellen Gesundheitszustand ab, wodurch später hinzukommende Diagnosen/Krankheiten keine Auswirkungen mehr auf den Beitrag haben. Ebenfalls kann es zu keiner Ablehnung oder Rückstellung eines Antrags kommen.
Gerade für Lehramtsstudenten/-innen, die noch an der Universität sind, Polizisten, Feuerwehrbeamte, Soldaten, Zollbeamte und Beamte der Justiz ist eine Anwartschaft unverzichtbar.
Mit der Verbeamtung auf Widerruf erhalten dann Lehrerinnen und Lehrer sowie andere Beamte die Beihilfe. In diesem Moment kann die Anwartschaft (Option) aktiviert und zur beihilfekonformen Krankenversicherung werden.
Bei den Beamten im Sicherheitssektor (Soldaten, Polizei, Feuerwehr, Zoll oder Justiz) wird die Anwartschaft erst mit der Pensionierung aktiviert und so zur beihilfekonformen Krankenversicherung. In der Regel wird die Anwartschaft in diesem Bereich immer in Kombination mit der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung geführt.
Erkrankt oder verunfallt ein Beamter ohne Anwartschaftsversicherung bevor die private Krankenversicherung abgeschlossen wurde, ist eine Aufnahme oftmals nicht mehr oder nur mit hohen Beitragszuschlägen möglich. Mit der Anwartschaftsversicherung ist jeder angehende Beamte und Heilfürsorgeberechtigte auf der sicheren Seite.
Auswahl aus über 40+ Privaten Krankenkassen